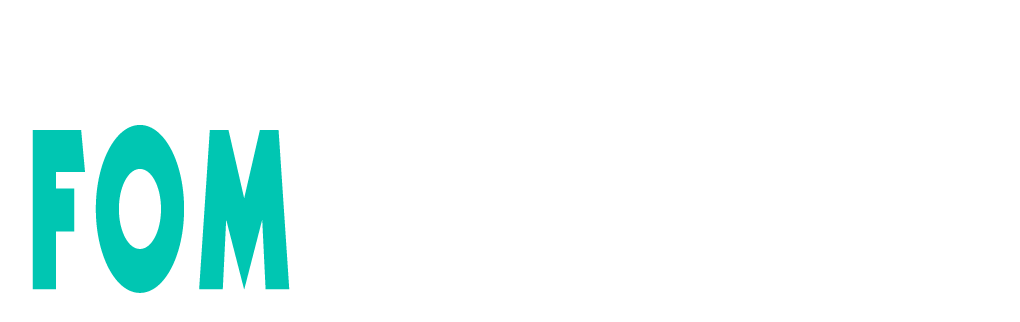Service für Journalistinnen und Journalisten
Für Medienanfragen steht Ihnen unser Presse- und Redaktionsteam gern zur Verfügung. Zum Service zählen:
Pressemitteilungen über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen
Vermittlung von Expertinnen und Experten für Interviews
Weitergabe von Bildmaterial für redaktionelle Berichterstattung
Profiltexte über die FOM Hochschule